- 22. März 2020
- Gastbeitrag, Gesundheit
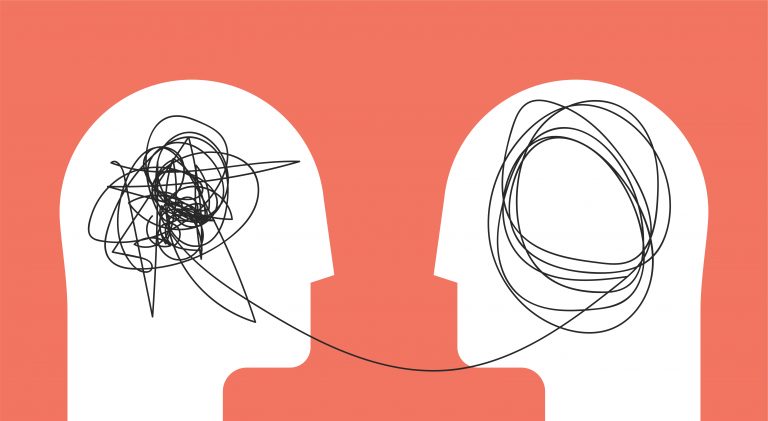
Psychische Gesundheit
und warum wir auch heute darüber sprechen sollten
Panikattacken, langfristige Niedergeschlagenheit, der Zwang, die eigenen Schritte zu zählen, wenn man geht, Wahrnehmungsstörungen, Aggressivität: Jedes Jahr sind etwa 30 Prozent der Erwachsenen von psychischen Erkrankungen betroffen, 2017 war jede*r Arbeitnehmer*in im Durchschnitt zweieinhalb Tage wegen psychischer Erkrankung krankgeschrieben. In leichten Fällen vergeht eine Angststörung oder Depression von alleine, in vielen Fällen brauchen die Menschen aber Hilfe: Einen Therapieplatz oder zumindest kurzfristige Beratung.
Und auch wenn sich durch die 2017 in Kraft getretene neue Psychotherapie-Richtlinie an manchen Stellen die Situation verbessert hat, ist die Situation vor allem im ländlichen Raum immer noch katastrophal. Durchschnittlich fünf Wochen wartet man in Bayern auf einen Termin für ein Erstgespräch, wobei es auf dem Land auch deutlich länger dauern kann. In einigen Landkreisen müssen etwa ein Drittel der Menschen, die Beratung aufsuchen wollen, mehr als 16 Wochen – also vier Monate! – auf einen Termin warten. Wer sich entschließt, psychologische Beratung aufzusuchen, hat meistens schon einen Leidensweg hinter sich.
Oft dauert es lange, bis man selbst erkennt, dass das, was gerade mit einem passiert, nicht normal ist. „Reiß dich ein bisschen zusammen“, denkt man sich vielleicht selbst, oder bekommt diesen ausgefeilten Ratschlag von anderen. Aber irgendwann merkt man, dass es mit zusammenreißen nicht getan ist. Dass man sich noch so sehr anstrengen kann, es wird einfach nicht besser. Aber auch dann versucht man es vielleicht nochmal: So zu funktionieren, wie es die Gesellschaft erwartet. Dass die Art, wie wir aktuell unser Leben leben (müssen) psychische Krankheiten zwar nicht alleine hervorruft, zumindest aber fördert, kann kaum verleugnet werden. Zeitlicher Stress und Leistungsdruck gelten bei den meisten psychischen Krankheiten als Risikofaktoren. Sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, ist etwas, was wir in unserer bereits in der Schule stark auf Vergleich ausgelegten und ellbogengeprägten Gesellschaft leider kaum lernen.
Es erfordert Mut, den Schritt zu gehen, und eine*n Therapeut*in aufzusuchen. Oder besser: anzurufen. Denn dann heißt es in den meisten Fällen zunächst warten. Nach dem Erstgespräch erfolgt – wenn es nötig ist – die Weitervermittlung in eine Akutbehandlung (das entspricht 24 Terminen à 25 Minuten) oder eine tiefergehende und länger andauernde Therapie, die sogenannte „Richtlinienpsychotherapie“. In mehr als der Hälfte der Beratungsfälle kann der*die Therapeut*in, der*die in der Sprechstunde das Erstgespräch durchführte, eine solche Therapie nicht selbst durchführen – zum Beispiel weil die Praxis bereits ausgelastet ist oder die Chemie zwischen Patient*in und Therapeut*in nicht passt. Bei der Weitervermittlung kommt es erneut zu teilweise sehr langen Wartezeiten, häufig von mehreren Monaten. Je länger man warten muss, desto höher wird das Risiko, dass psychische Erkrankungen sich verschlimmern oder sehr viel länger andauern.
Dass Wartezeiten auf dem Land häufig länger sind als in der Stadt, liegt vor allem an der fehlerhaften Bedarfsplanung der Krankenkassen. Während es in Städten pro 100 000 Einwohner*innen etwa 36 Psychotherapeut*innen gibt, sind es in ländlichen Regionen lediglich 12 bis 18. Es wird angenommen, dass psychische Erkrankungen in ländlichen Gebieten seltener vorkommen. Diese Annahme ist schlichtweg falsch. Um Wartezeiten in Land und Stadt zu verringern, braucht es dringend eine Umstellung der Bedarfsplanung und eine massive Aufstockung der psychotherapeutischen Praxissitze. Besonders bei Kindern und Jugendlichen sind lange Wartezeiten für Therapieplätze mit gravierenden Folgen verbunden, sodass hier die Praxissitze in besonderem Maße ausgebaut werden sollten. Dabei sollte auch beachtet werden, dass psychotherapeutische Praxen gut erreichbar sind und es keine weißen Flecken auf der Landkarte gibt, damit jede*r in einer angemessenen Zeit eine Praxis erreichen kann – denn auch lange Fahrtzeit kann eine Hürde sein, die Menschen davon abschreckt, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch in der stationären Behandlung müssen die Plätze massiv ausgebaut werden. Hier ist es sogar denkbar, mehr Plätze anzubieten, als durchschnittlich belegt sind, um dem Fall vorzubeugen, dass Menschen, die eine Therapie dringend nötig haben, abgewiesen werden.
Dies sind nur einige Maßnahmen, die in der psychotherapeutischen Grundversorgung angegangen werden müssen. Auch zum Beispiel Gruppenangebote und die Prävention psychischer Krankheiten könnten und sollten stärker gefördert und ausgebaut werden, ebenso wie niederschwellige psychologische Beratungsangebote an Unis, Hochschulen, Schulen und Ämtern – Orten, an denen Menschen sich sowieso regelmäßig aufhalten.
Bei all den Dingen, die aktuell nicht so gut laufen, muss man jedoch auch Entwicklungen nennen, die ich aktuell positiv wahrnehme: Wir sprechen mehr und mehr über psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen. Zumindest nehme ich das in meiner Bubble so wahr. Und das ist wichtig. Besonders, wenn es jemandem nicht so gut geht, kann es ihr*ihm gut tun, zu erfahren, dass sie*er nicht die einzige Person ist, die mit einem Problem kämpft und dass es Menschen gibt, die sie*ihn unterstützen. Gemeinsam können wir es schaffen, im ersten Schritt Inseln in einer Gesellschaft der Ellbogen und des Egoismus zu kreieren und damit nach und nach unsere Gesellschaft zu verändern – hin zu einer solidarischen Gesellschaft, in der sich jede*r frei entwickeln und entfalten kann.
Die Fürsorge für sich und andere ist auch aktuell sehr wichtig. Durch die Maßnahmen in der Coronakrise, in der wir uns alle gemeinsam bemühen, so wenig Ansteckungen wie möglich zu erreichen, ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die Sozialkontakte im direkten Kontakt soweit wie möglich zu reduzieren. Das sorgt dafür, dass wir weniger sozialen Austausch haben, welcher aber für die psychische Gesundheit sehr wichtig ist. Zusätzlich werden wir aus unseren Routinen gerissen. Dinge, die unseren Tag strukturieren – morgens zur Arbeit oder Schule fahren, gemeinsam mit anderen Mittagessen, abends vielleicht zum Sport oder auf eine Sitzung – entfallen. Vor allem für Menschen, die psychische Erkrankungen haben oder einfach (aktuell) nicht ganz so belastbar sind, sind diese Strukturen im Alltag aber hilfreich, um Stabilität zu erzeugen und sich nicht zu viel mit sich selbst zu beschäftigen („Grübeln“ ist vor allem bei Depressionen etwas, was zur Verschlimmerung der Situation beiträgt). Menschen, die weiterhin arbeiten müssen, weil sie nicht das Privileg haben, im Homeoffice arbeiten zu können und vielleicht sogar in der Pflege nun viel mehr arbeiten müssen, haben zusätzlich zur Arbeitsbelastung ein höheres Ansteckungsrisiko, was bei vielen mit Angst und Sorge verbunden sein wird.
Deshalb: Kümmert euch – um euch selbst und um eure Freund*innen, sprecht darüber, wie es euch geht und fragt andere danach. Wir haben über die sozialen Medien vielfältige Möglichkeiten, miteinander Kontakt aufzunehmen und es tut gut, sich zu unterhalten oder sogar via Videocall zu sehen. Tut Dinge, die euch gut tun – lesen, Yoga, ein kleiner Spaziergang, den Kleiderschrank ausmisten, vielleicht nicht unbedingt fünf Stunden auf Twitter oder Instagram abhängen. Fragt nach Hilfe und Kontakt, wenn ihr euch alleine nicht gut fühlt. Kurz: Achtet auf eure Gesundheit – psychisch und körperlich.

